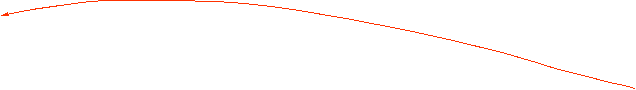Am Anfang: nüchternes Arbeitslicht ohne jede theatralische Illusionierung. Kein falscher (Bühnen-)Zauber. Der Raum wird von einer mehr als mannshohen
Eisenplattenkonstruktion diagonal zerschnitten. Lange Zeit geschieht nichts
oder fast nichts. Geräusche zunächst nicht zu identifizieren, nähern sich, werden lauter, nehmen ihren Weg scheinbar jenseits der Eisenwand und
verlieren sich wieder. Eine Reihe von Spiegeln, angebracht über den Eisenplatten, versprechen dem Zuschauer zumindest kleinere Einsichten,
mosaikhaft gebrochene Ausschnitte eines vermuteten Geschehens auf einer anderen
Seite. Abhängig davon, wo er sich selber befindet, kann er vielleicht ein aufmerksam
beobachtendes Gesicht, Teile menschlicher Körper in Bewegung, später auch Fragmente weiterer Akteure identifizieren.
Dann der resolute Auftritt einer Frauengestalt: „We shall commence with 5 kilometers, ladies and gentlemen.“ Ein aufmerksamer Blick in die Runde: „Are there / thank you. 6 kilometers. 7 kilometers.“ Später geht es über „50 kilometers“ weiter zu 60, 61, 62, 63. Konzentriert und selbstverständlich nimmt vor den Augen der Zuschauer das streng formalisierte Ritual einer
absurden Auktion ihren Anfang, die routinierte Prozedur einer Versteigerung im
Zeichen des Schneller, Weiter und Länger. Später, wenn die Sprecherin ihre Kilometerangaben bereits lange zugunsten von
Meilen aufgegeben hat, kommt ihr die Geläufigkeit der Rede zusehends abhanden: Die da eben noch so scheinbar mühelos und souverän ihre atemberaubenden Geschwindigkeitspirouetten drehte, gerät ins Stocken, verfängt sich in Versprechern, versucht vergeblich, in immer neuen Ab- und Auftritten
ihre Fassung wiederzuerlangen, bis sie ihre stereotyp hysterische Verzweiflung
schließlich im Kampf gegen den eigenen Körper austrägt: Einer Fliege ähnlich, die bei der Suche nach einem Ausweg bis zur Erschöpfung gegen die Fensterscheibe anfliegt, wirft sie sich auf die Erde, gegen
Mauern und Wände; sie bemüht Fragmente von (Tanz-)Bewegungen, probiert Bruchstücke von Verzweiflungsgesten und Trauerhaltungen – und bezeichnet damit doch nur die immer neuen, immer aggressiveren Versuche
eines wildgewordenen Körpers, mit aller Gewalt (auch und vor allem gegen sich selber) so etwas wie eine
Sekunde der wahren Empfindung zu erzwingen.
„Weitergehen. Immer weitergehen.“ Was die Zuschauer diesseits der Eisenwand anfangs vielleicht nur
unterschwellig, als bloßes Murmeln, wahrnehmen und nur bei genauem Hinhören überhaupt lokalisieren und identifizieren können, gibt sich in einer späteren Phase als komplementäres Programm im doppelten Sinn des Wortes zu erkennen: Zunächst auf der anderen Seite der Wand und damit auch ganz konkret schon als ‚Andererseits’ formuliert, findet es jetzt auch hier zur Sprache: Stereotyp wiederholt von
einem Kämpfer mit Schwert, beschwört der Wahlspruch in Verbindung mit den abgezirkelten Bewegungsabläufen eines martialischen Kampf-Rhythmus gleichsam das Gegenmodell zur weiblichen
Figur einer hysterischen Auflösung: die ritualisierte, im Ritual gebändigte, kontrollierte und disziplinierte Aggression eines maschinenhaft-männlichen Körperkorsetts in Bewegung.
„Und verstehen/erklären wollen. Wenn der Körper und seien Bewegung bislang in der konkreten Anschauung, im realen Ablauf
des Geschehens zur Darstellung gekommen sind, so kommen sie auf einer nächsten Ebene als Gegenstand der Reflexion zu Wort. Mit Lust auch am Beispiel der
eigenen Person („Ich bin gotisch – und ein ganz klein wenig aufgeklärte Renaissance … Botticelli“) breitet eine Intellektuelle der Neunziger Jahre ihre zeitgemäßen Einsichten und Erkenntnisse in einer Art Vortrags-Performance aus: In den
Randzonen zwischen privater Rede, gescheitem Party-Small-Talk, theatralischer
Improvisation und kunsthistorisch-zivilisationskritischem Volkshochschulvortrag
lavierend, spricht sie jenseits der Mauer zunächst über epochengeschichtliche Ideal-Imaginationen des Weiblichen (das heißt: über die Geschichte der Kultivierung, Domestizierung und Disziplinierung des Körpers), um anschließend diesseits der Mauer über die Dialektik von zunehmender Beschleunigung und erzwungener Ruhe zu räsonieren. Ohne in Ulk oder Satire abzugleiten, öffnet sie dabei alles vordergründig Inhaltliche einer potentiellen ‚Botschaft’ auf seine latente Komik hin.
Am Schluß: Weiter/ Laufen/ Lassen. Eine konsequente Absage an Theatergepflogenheiten auch
jetzt: keine Verbeugung vor keinem Publikum. Kein Beifall. Kein Schluß. Die drei Akteure verschwinden irgendwann. Das letzte Wort (unausgesprochen)
haben die Langstreckenläufer: Was dem aufmerksamen Zuschauer im Laufe des Abends zumindest zur Vermutung
werden konnte, wird ihm nach Verlassen des Theaterraums zur Gewißheit. Unbeirrt von allen Anstrengungen im Kunstraum zeihen draußen in den Foyers des Gasteig Läufer und Läuferinnen ihre Kreise, passieren dabei immer wieder auch den Laufkanal, der
durch die Black Box führt, holen den Alltag ins Theater – nahezu unbemerkt. Der Rhythmus des Laufens, die konkreten Äußerungen der laufenden Körper, mal ein vereinzelter Läufer, mal eine größere Gruppe, dann wieder lange Pausen – Grenzgänge am Rande des Alltäglichen.
Gedankensplitter/ Beobachtungssplitter. Samuel Rachl und Angela Dauber stellen
mit ihrem Projekt die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit von Wahrnehmung und spielen sie konkret durch – am Beispiel unterschiedlicher Formen und Erscheinungsweisen des menschlichen Körpers und seiner Bewegung im Raum. Dabei zielen sie keine Sekunde auf die
Demonstration einer vorgegebenen These, sondern eröffnen dem Zuschauer mit Hilfe ihrer raum- und wahrnehmungs-bestimmenden
Laufkanal/Spiegel-Installation eine allmähliche, zugleich spannend und spannungsvoll entwickelte Einsicht in die
Bedingtheit seiner Sicht auf die Welt. Mit wachsender Erkenntnis, daß er mehrere unabhängig voneinander verlaufende Ereignisstränge gleichzeitig verfolgt, kann jeder Zuschauer die sinnlich-konkrete Erfahrung
subjektiv reduzierter und gebrochener Erfahrungsmöglichkeiten machen. Was der einzelne wahrnimmt, das macht das Projekt „kein Auto kein Haus weder Mann Frau noch Kinder“ deutlich, sind allenfalls isolierte Eindrücke, Partikel des Lebensstromes, fragmentiert und zerrissen.
Jan Schulz

Fotos Alma Larsen